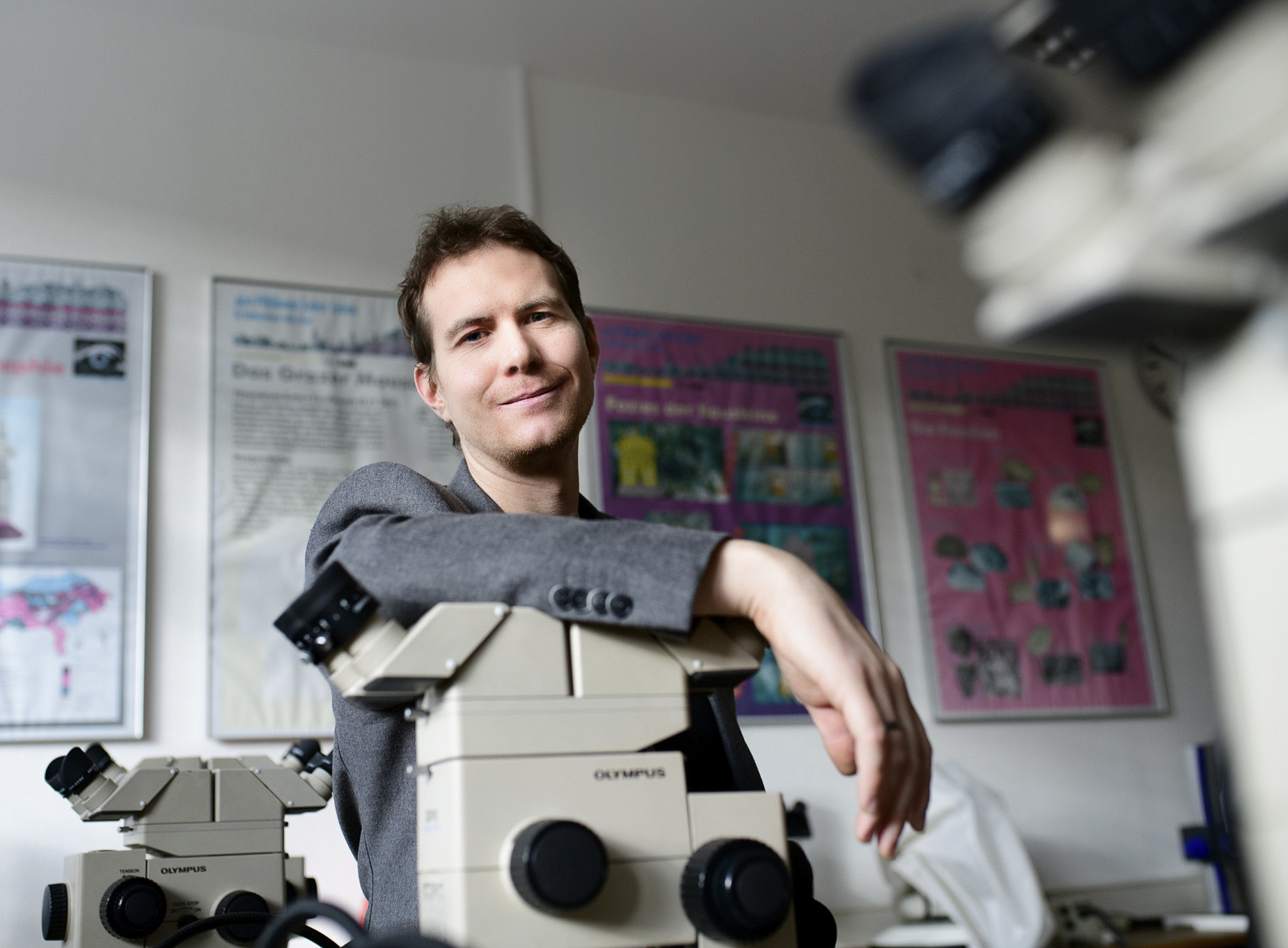„Ein Ansteigen der Wassertemperatur verlangsamt die Zirkulation in den Ozeanen“, erklärt Gerald Auer, Erdwissenschaftler an der Universität Graz. Das Abschmelzen des Meereises dürfte diesen Prozess stark beschleunigen und hätte außerdem Folgen für das Plankton sowie die gesamte Nahrungskette. „Darauf haben wir bei unseren Forschungsarbeiten deutliche Hinweise gefunden“, schildert Auer. Er ist Co-Leiter des internationalen Projekts „Tracing Intermediate Water Current Changes and Sea Ice Expansion in the Indian Ocean”, das untersucht, wie sich Klimaveränderungen auf Meeresströmungen ausgewirkt haben. „Der Klimawandel beeinflusst auch den Nährstofftransport und damit die Lebensbedingungen im Wasser“, ergänzt der Wissenschaftler.
Im Rahmen eines Pilotprojekts des International Ocean Discovery Programs am Kochi Core Center in Japan hat das Team Zugriff auf einzigartige wissenschaftliche Bohrkerne von Millionen Jahre alten Sedimenten aus dem Indischen Ozean. „Daran erkennen wir die Folgen von Klimaveränderungen und können direkte Analogien für zukünftige Szenarien finden. Das ist ein wertvoller Beitrag, die Auswirkungen des Klimawandels auf den Nährstoffkreislauf unsere Ozeane zu verstehen“, berichtet Auer.
Die Forscher:innen vermuten ein Einbrechen des Nahrungsangebots in der Nähe des Äquators. Was das bedeuten könnte, haben sie soeben in einer Studie in Climate of the Past veröffentlicht: Wärmere Klimabedingungen, wie sie für die nächsten Jahrhunderte vorhergesagt werden, verringerten vor zwölf Millionen Jahren die Nährstoffe im Ozean. Im Arabischen Meer gab es dadurch viel weniger und ganz anderes Plankton als heute. Erst durch die Vereisung der Antarktis konnte sich die marine Nahrungskette in ihrer jetzigen Form entwickeln.
Die Forschungsarbeit des österreichischen Teams in Japan – neben Graz war auch die Universität Wien beteiligt – wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Wissenschaftsfonds FWF sowie einer Initiative des European Consortiums for Ocean Drilling finanziell unterstützt. Die Forschung fand in Zusammenarbeit mit dem Atmosphere and Ocean Research Institute der Universität Tokio, der Universität Kochi und der Japan Agency for Marine Earth Sciences and Technology statt.